
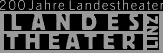

forum stadtpark theater / dramagraz,
schauspielfrankfurt, Frankfurt / Main, Museum der Wahrnehmung, Graz (KÖRPER
UND FRAU)Literaturhaus Graz / Graz 2003 (DAS SCHWEIGEN)
| dramagraz |
 |
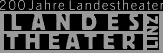 |
 |
| co-produziert
mit:
forum stadtpark theater / dramagraz,
schauspielfrankfurt, Frankfurt / Main, Museum der Wahrnehmung, Graz (KÖRPER
UND FRAU)Literaturhaus Graz / Graz 2003 (DAS SCHWEIGEN) |
 |
||
 |
Elfriede
Jelinek :WER WILL ALLEIN SEIN: >eine untersuchung (UA) |
|
|
|
||
| >eins: KÖRPER UND FRAU >eine
entäußerung >mit Juliane Werner >Montage: Ernst M. Binder >zwei: DAS
SCHWEIGEN >einer dieser vergeblichen versuche >drei: ALLEINSEIN >ein tatsachenbericht >Konzept / Inszenierung: Ernst M. Binder Uraufführung der Trilogie: 18. November 03,
20.00 Uhr |
||
| Zur Autorin: Elfiede Jelinek |
Elfriede Jelinek stand immer abseits von Strömungen und Trends. Aufrührerisch und teils blasphemisch stellte sie genau jene Positionen in Frage, auf denen man sich gerade bequem niedergelassen hatte: Zu Zeiten, als der Feminismus auch bei Männern Mode wurde, führte sie mit „Die Liebhaberinnen“, „Clara S.“ und „Krankheit oder Moderne Frauen“ den Frauen ihre selbstverschuldete Unmündigkeit vor. Als die neue Innerlichkeit aufkam und alle wieder sensibel wurden, schrieb sie ihren mit Selbsterniedrigung und Selbstekel gespickten Roman „Die Klavierspielerin“. Und schließlich hat sie sich in „Ein Sportstück“ und „In den Alpen“ sogar noch am allerheiligsten Kult der Gegenwart vergriffen: dem Sport. Als Produzentin derart widersetzlicher Werke wurde sie zu einem willkommenen Angriffsziel rechtsorientierter Kreise und der Boulevardpresse, die seit dem Tod Thomas Bernhards ja niemand mehr hatten, den sie als „Nestbeschmutzer“ beschimpfen konnten. Doch wie Elfriede Gerstl, Schriftstellerkollegin und enge Freundin Jelineks, meint: Wer vor Jelineks Texten erschrickt, erschrickt vor sich selbst, vor seinen Rachefantasien, seiner Wut auf die Beschränktheit der Mitmenschen, auf die einengende Mutter, den übermächtigen Vater etc. Was an der Autorin aufregt, sind vielleicht weniger ihre provokanten Themen als vielmehr die Auflösung der Persönlichkeit, die Jelinek betreibt. Das Ich löst sich auf in medialem Sprechen: Wenn eine Person ihr Innenleben formuliert, so tut sie es mit Versatzstücken aus Presse, Fernsehen, Werbung, politischen Ideologien und Geistesgeschichte. Das von vorgetäuschter Gemütlichkeit vollgepropfte Gesülze der Heimatfilme, die von Gehässigkeit dampfende Rede der Politiker, die von reaktionärer Verstocktheit geprägte Alltagssprache wird ebenso satirisch verdichtet und dem Verlachen preisgegeben wie das von Floskeln überbordende Geschwafel der künstlerischen Elite. „Sieh deiner Selbstentfremdung ins Gesicht“, fordert die Autorin und zeigt uns mit beißendem Humor und einer gehörigen Portion Sarkasmus unsere Befangenheit in Vorurteilen und Klischees. Auszeichnungen
(Auswahl): Werke (Auswahl):
|
| Zum
Stück: Wer will allein sein
Viel stärker als mit allen
unerwünschten Themen und Entheiligungen verletzt Seit jeher war die Selbstwahrnehmung der Frau eines der Hauptthemen in Jelineks Stücken: als Arbeiterin, als Denkerin, als moderne Ehefrau, als Sexobjekt, als Gebärmaschine. In :WER WILL ALLEIN SEIN:, einer Trilogie aus den Texten „Körper und Frau“, „Das Schweigen“ und „Alleinsein“, erzählen die auftretenden Frauengestalten über ihre Probleme mit dem Weiblichkeitsbild der heutigen Gesellschaft, über ihr Scheitern am Mitmenschen, an der Gesellschaft, an der Geschichte, an der Kunst und vor allem an sich selbst. Der Monolog KÖRPER UND FRAU ist die Geschichte des Verschwindens eines Unterwäschemodels namens Claudia hinter Schminke, Mode und cellulitefreien Oberschenkeln. Davor steht jedoch eine Zwiesprache der Frau mit ihrem Körper: Das Lustobjekt, die Projektionsfläche überzogener Schönheitsideale trifft auf die anderen Aspekte von Claudia: auf die blasierte Göttin, die biedere Hausfrau, den männermordenden Vamp, die enttäuschte Tochter. In der für Jelinek so typischen bildgewaltigen, obsessiven Sprache wird die konventionelle Auffassung jeglicher Identität dekonstruiert und die Schwierigkeit weiblicher Selbstdefinition auf den Punkt gebracht. Im zweiten Teil des Abends - DAS SCHWEIGEN - nimmt sie das dem Schriftstellerdasein immanente Streben nach dem Höchsten, dem Ewigen, dem Allumfassenden aufs Korn, in dem sie den Versuch, eine Biografie des Komponisten Robert Schuhmann zu verfassen, um-, auf- und be-schreibt. Mit Sprachwitz und Selbstironie erzählt sie vom Scheitern des Dichters – einem Scheitern, das nur ins Schweigen münden kann.
Den Abschluss des Abends bildet
der hochaktuelle Text ALLEINSEIN, in dem Jelinek das Frausein im gesellschaftspolitischen
Kontext thematisiert. Sie zeigt „die politische Aufschaukelung von
Terror und Pazifizierung“ als „eine Art Aufladung der Gegenwart
mit Männlichkeit, die die Weiblichkeit verdrängt“. Gemeinschaft
- egal ob im kleinen Kreis der Familie oder in den unüberschaubaren
Netzwerken der globalisierten Welt - kann nicht existieren, wenn die größere
Hälfte der Menschheit, nachdem man sie verschleiert bzw. in Dirndlkleider
gezwängt und zum Putztrampel degradiert hat, nur mehr die Rolle des
Sündenbockes spielen darf. |
| Ernst M. Binder |
 freier Autor, Regisseur und Musiker; seit 1987 Leiter des forum stadtpark theater / dramagraz. 60 Inszenierungen im In- und Ausland, davon 39 Ur- und Erstaufführungen; 3 Einladungen zum Mülheimer Theatertreffen, 3 Nominierungen zum Berliner Theatertreffen, 2 Einladungen zum Heidelberger Stückemarkt sowie weitere Teilnahmen an renommierten Theaterfestivals. Wichtigste Inszenierungen u. a.: Die Osiris Legende von Peter Glaser (steirischer herbst 1988), Mein Hundemund von Werner Schwab (Schauspielhaus Wien 1992), Totentrompeten von Einar Schleef (Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin 1995), Aus nichts wird nichts von Bertold Brecht (Berliner Ensemble 1997), Es singen die Steine von Gert Jonke (Stadttheater Klagenfurt 1998), Woyzeck (Slowenisches Nationaltheater DRAMA Ljubljana 2002), Black Jack von Franzobel (Festwochen Gmunden 2003). |
| Josef Klammer |
 Komponist und Schlagzeuger; Mitglied des Klammer&Gründler Duos; Mitbegründer von V:NM (Verein zur Förderung und Verbreitung Neuer Musik) und Organisator des gleichnamigen Festivals; seit 1988 Theatermusik in Zusammenarbeit mit Regisseuren wie Martin Kusej, Ernst M. Binder, Zdravko Haderlab u. a.; Konzeption und Sound- und Musicprogramming für Klangprojekte; Komposition und Gestaltung etlicher Sendungen für ORF/Ö1/Kunstradio; Auftragskompositionen für das musikprotokoll (steirischer herbst), die Stadt Graz, das Diagonale-Filmfestival, das Institut für Elektronische Musik und Akustik der Musikuniversität Graz usw. |
| Juliane Werner |
© Wolf/dramagraz |
| Bettina Buchholz |
© Binder/dramagraz |
| Pressereaktionen JELINEK : TRILOGIE |
| trilogie I |
| KÖRPER UND FRAU |
| Frankfurter
Neue Presse 10.01.2003
Eine Frauen-Stimme entstieg der Kloschüssel Ernst M. Binder brachte Elfriede Jelineks "Körper und Frau" nach seiner Grazer Ur- zur deutschen Erstaufführung im Schauspiel Frankfurt. Nach Marx ereignet sich Historisches gern zwiefach:
erst als Tragödie, in der Wiederkehr als Farce. Ob Gleiches für
die politische Theorie gilt? Was der für Jelineks Dramen zentrale
dekonstruktive Feminismus über den weiblichen Körper als Projektion
männlicher Weiblichkeitsideale vorbringt, erinnert unter Lagen aus
Jargon sonderbar an die zwei Körper des Königs im Feudalismus:
den sterblich-physischen und den rechtlich-politischen, dem der Tod so
wenig anhaben kann wie das Alter dem Cover-Model. Getreu dem Untertitel
ihres von Binder um mehr Jelinek-Fragmente ergänzten Stücks
thematisiert die Dramatikerin ein analoges Auseinandertreten von "Körper
und Frau" auf Kosten des Ichs: der Spiegel-Körper der Schönheits-Königinnen
im Zeichen der Ohn-Macht. Was nicht zwingend nach Bühnenwirksamkeit
klingt. Umso mehr war das Theater im "Glashaus" gefordert, dem
Igel des szenischen "Schotters" im Wettlauf mit dem Hasen des
von A bis Z bewussten Feminismus der Autorin, der immer schon da ist,
zum Sieg zu verhelfen. Binder und seiner gut aufgelegten, gut instruierten
Darstellerin Julia Werner gelang es binnen 50 Minuten durch eine kräftig-asketische
Regie, gepaart mit konzentrierter Diktion und sparsamer Gebärde,
die dosierte Steigerungen zuließ. Abgesehen vom "Dialog"
mit der Stimm-Konserve aus dem Off, die später einer Kloschüssel
entstieg, kamen wenige Hilfsmittel zur Anwendung. Das Bühnenbild
(Carlos Schiffmann) aus Podien und besagter Sitzgelegenheit glich unter
Lichtröhrenkranz und Gewandfalten einem Thron, bis "Claudia"
ihre Prinzessinnenpose und Höhere-Tochter-Maske aufgab. Das purpurn
hochgeknöpfte Gewand riss sie auf, die Sanitärkeramik wurde
sichtbar. Das zweite waren die Kostüme (Andrea Platbusch), denn was
begleitet von regerer Körpersprache zum Vorschein kam, war ein violettrosa
Klofrauenkittel mit barbiefarbenen Latschen; der strenge Scheitel wich
vulgär bezopfter Asymmetrie. Der Rest war Text: Bekenntnis der "Glühendschönen"
in die Kanalisation, Stenogramm des Ich-Zerfalls in die "membra disiecta"
(zerstreute Glieder) der modernen Venus; Nase, Schmollmund, D-Körbchen.
Marcus Hladek |
Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 10.01.2003
Claudia, bleib! Elfriede Jelineks "Körper und Frau" in Frankfurt Die Dame in Rot sitzt auf einem Sockel, mit strenger Miene und akurat gezurrtem Scheitel, völlig unbeeindruckt von allen, die sie anstarren. Über ihrem Kopf hängt ein Lichtgeviert aus Neonröhren, hinter ihr geben die großen Glaswände im Frankfurter Schauspielhaus den Blick auf die nächtliche Stadt frei. Wenig später wird die Schauspielerin Juliane Werner mit zerhackter Stimme von betonierten Flüssen und Blutströmen, von Mode und Mutterhaß, von Körpern, Sport und Krieg sprechen und dabei munter alles in eins mischen, sie wird langgezogen kreischen, heiter lächeln, zum Beifall für Kriegsverbrecher auffordern und sich einen blondgelockten Zopf ins Haar stecken - daß ihr Spiel nie in den Verdacht des folgenlosen Radaus, des bloß Beliebigen gerät, verdankt sich dieser anfänglichen konzentrierten Stille, deren Erinnerung als Gegenpol den gesamten einstündigen Theaterabend beherrscht. Elfriede Jelineks Stück "Körper und Frau" wurde mit Juliane Werner im vergangenen September in Graz uraufgeführt. Jetzt ist es mit derselben Schauspielerin als deutsche Erstaufführung in Frankfurt zu sehen. Der Monolog, der sich immer dann zum Dialog der Schauspielerin mit einer Tonbandstimme weitet, wenn eine Frau namens Claudia Zwiesprache mit ihrem Körper hält, läßt Rollenbilder einer Frau entstehen, die sich zwischen Göttin und Model, vaterliebender Tochter und gefügiger Hausfrau bewegen.Der Text durchläuft das gesamte Sinnspektrum zwischen kryptisch und banal ("Sprechen ist, wenn die Stille endlich still ist"), integriert Fragmente aus Jelineks "Der Wanderer", "Todtnauberg", "Sportstück" und "Mode", und wie in diesem erkennbar von Assoziationslust beflügelten Wortsalat alles irgendwie zu allem paßt, erweist sich die Klammer, die das Ganze zusammenhalten soll, manchmal als deutlich überdehnt. Es geht um die Distanzierung vom eigenen Körper, um Verkäuflichkeit und Vereinnahmung, um das Bewußtsein, mit dem eigenen Leib über eine Ware zu verfügen, die den ohnmächtigen Neid der anderen erregt: "Claudia. Bleib Körper, Claudia, bleib", murmelt die Tonbandstimme dazu, und Claudia, mittlerweile in eine rosa Schürze gekleidet, fragt verstört: "Wo ist denn bloß mein Schlüssel zu mir? Egal!" Daß dabei insgesamt dennoch ein gelungener Theaterabend herauskommt, ist Juliane Werner geschuldet. Wie sie diesen disparaten Monolog trägt, wie sie die unterschiedlichsten Rollen spielt und gleichzeitig den Abend über bündelt, wie sie Körper und Stimme in einer selbstverständlichen Präzision einsetzt, die alle vorausgegangene Arbeit unsichtbar macht, weist sie als wunderbar stimmige Besetzung in einem schwer zu spielenden Stück aus. Tilman Spreckelsen |
|
|
DER
STANDARD, 20. 09. 2002
Augsburger Puppenspielerin Die gelungene Elfriede-Jelinek-Montage "Körper und Frau" im Grazer "Museum der Wahrnehmung" legt nahe: Vielleicht ist eine Jelinek-Rezeption erst jenseits der Staatstheater denkbar. Graz - Von gänzlich unvermuteter Seite, sozusagen aus der Tiefe der Zeit herauf, stiehlt sich ein vergessen geglaubter Bundesgenosse an die Seite der Elfriede Jelinek: ein konfuzianischer, ganz aus der Mode geratener Weiser, der die Schauspieler so lange aus den Umrissen ihrer Figuren verscheuchte, bis sie zu ihren Dressurkörpern, diesen Zauberinstrumenten der Illusionstechnik, gebührlichen Abstand hielten. Einfühlung und tätiger Nachvollzug waren
diesem listigen Reformer ein Gräuel; seinen exilgebastelten Taschenbuch-Marxismus
sieht man ihm heute noch an. Darum will ihn - außer Sektierern -
auch keiner mehr beim Augsburger Namen kennen. In dem schmucken Gartenbau sitzt eine in roten Samt
gehüllte, zugeknöpfte Frauensperson (Juliane Werner) als wasserbleiche
Figurine auf einem Denkmalsockel: das Strohhaar streng gescheitelt, die
Hände flach auf den Schenkeln: ein spätjüngferliches Echo
auf die vielen unaufgeklärten Bürgermädchen, die ihren
adeligen Verführern aus Gründen der Herzensbildung eigensinnig
lustzickig widerstanden, als Limonaden-Luise oder Dolchstoß-Emilia
zum Damenopfer freigegeben. Die Begriffe "Frau" und "Fluss" und "Körper" schwimmen sich frei und beginnen miteinander Unzucht zu treiben: erwärmen sich, erhitzen, explodieren. Sie treten über die Ufer des Sinns und reißen alle Bedeutungshöfe mit sich mit in ihrer gurgelnden Flut. Langsam platzt Juliane Werner heraus aus dem Korsett von Sitte und Überlieferung, knöpft sich frei und schießt gleich los - und treibt die Elfriede-Jelinek-Collage Körper und Frau, eine Montage aus Prosateilen und Stückflächen, in ein wunderbar heißkaltes, jederzeit kunstkalkuliertes Delirium hinein. Postdramatisches Theater, wenn man so will; eher
aber ein Korrelat zu Deleuze/Guattaris "kleiner" Literatur,
die hinter den Litfass-Säulen der Staatsdichterei wie ein Spuk verschwindet.
Niemals, auch nicht im sexy Nachthemd, stellt Werner das "Objekt" aus, sondern, mit durchdringend strahlenden Augen, im Echoduell mit einer delphisch raunenden Klosettmuschel, die leere Fläche weiblicher Identität. Barbie will Vormund sein: In diesem kleinen Abend könnte ein Ansatz zu einer neuen Jelinek-Rezeption im Theater liegen. Ronald Pohl |
Die
Presse, 23.09.2002
Jelinek in Graz: Venus auf der Klomuschel Ernst M. Binder inszeniert als erster wieder einen
Jelinek-Text in Österreich: "Körper und Frau" ist
eine "Entäußerung", die in Graz Äußerstes
abverlangt. Er siedelt in dieser Koproduktion des Forum Stadtpark Theaters mit dem Frankfurter Schauspiel den knappen, mit Auszügen aus "Der Wanderer", "Totenauberg", dem "Sportstück" und einem Essay der Wiener Mode-Liebhaberin gestreckten Text mit originellem Überraschungseffekt dann auch nicht weit vom Flatus entfernt an. Denn die Venus aus der Muschel entpuppt sich in der "Entäußerung" bald als Claudia auf der Klomuschel. Dabei gerät der Gag zur passenden Metapher für den sperrigen Monolog eines Models in der Identitätskrise, wenn die aparte Juliane Werner ihren Thron und die rote Samtrobe lüftet (an den Kostümen wirkte die Modekünstlerin Lisa D. mit) und im schlapfigen Hausfrauenkittel am WC über sich und die Welt draußen philosophiert. Das Sinnieren über Weiblichkeit und Wirklichkeit grast die Ufer von Unterdrückung, Verletzung, Objekt der Begierde und Verweigerung ab. Seichtes und Kopflastiges stehen Satz bei Satz. Assoziationen zur toten Natur und deren krampfhafter Renaturierung, Erinnerungen an den geistesgestörten Vater und die verhaßte Mutter, die "ein rotes Tuch in meiner Hand" ist, sowie das vom Körper zum Kopf wandernde Suchen nach dem Ich vermittelt Werner beeindruckend konzentriert und sensibel. "Oberflächentheater" wurde Jelineks Credo von der Nichtdarstellbarkeit des Lebens auf der Bühne genannt. Eine recht lebendige Rezeption gelingt Juliane Werner, die den Zuschauern freilich Äußerstes abverlangt. Elisabeth Willgruber-Spitz |
KLEINE
ZEITUNG, 19.09.2002
Jelinek-Monolog "Körper und Frau" im MUWA Am stillen Örtchen ist gut philosophieren über "Körper und Frau" und die Welt an sich. Ernst M. Binder hat Elfriede Jelinek für Graz bewegt. Sie hat Österreich wegen der FPÖ-Regierungsbeteiligung boykottiert. Er will im Moment mit seiner angestammten Heimstätte, dem Forum im grünen Herzen von Graz, nichts zu tun haben. Zwei Protestler unterschiedlichster Natur haben sich zusammengefunden. Elfriede Jelinek hob mittlerweile ihren Bann auf und bewilligte Regisseur Ernst M. Binder erstmals wieder die Inszenierung ihrer Texte in der Alpenrepublik. Gedankenspiralen. Um die Gedankenwelt des Models Claudia schifft der Monolog "Körper und Frau", mit dem das Grazer "forum stadtpark theater" ins Museum der Wahrnehmung im Augarten siedelte. Hell beleuchtet sind die stillen Örtchen im Foyer, wo Juliane Werner königlich erhaben vor dem Publikum thront und mit ihren konzentrierten Gedankenspiralen wartet, bis das letzte Klosett-rauschen verklingt. Optimale Körpermaße. Kein Theater im herkömmlichen Sinn ist angesagt. Angespanntes Mitdenken erfordern Jelineks weibliche Abgrenzungsversuche, die Binder mit Auszügen aus "Der Wanderer", "Totenauberg", "Sportstück" und einem Essay der Autorin zum Thema Mode montiert. Aufkeimender Witz offeriert sich Kennern der doppelzüngigen Zornabladerin Jelinek im Mix von banalen Kaffeekränzchen-Weisheiten und beklemmenden Einsichten, die über optimale Körpermaße hinausgehen. Hausmuttchen. Dass sich Werner dann während ihrer fast regungslosen, aber fesselnden Textwiedergabe als Hausmuttchen auf der Klomuschel entpuppt, erheitert nicht nur, sondern verleiht der Modelprinzessin Boulevardnähe zu Frau Jedermann. "Besetzt" signalisiert die innere und äußere Abgeschirmtheit gegenüber familiären wie gesellschaftlichen Verletzungen nicht nur bildlich. Nischentheater. Unter der Mitwirkung von Carlos
Schiffmann (Bühne) sowie Lisa D. und Andrea Plabutsch (Kostüme)
ist Binder bestes Nischentheater gelungen, das als Co-Produktion vom "forum
stadtpark theater Graz" mit dem "schauspielfrankfurt" zu
Jahresbeginn nach "Mainhattan" übersiedelt. |
|
Krone
OÖ, 26. 10. 2002
Körper & Frau im
Focus Elfriede Jelinek hat ihren Schreib-Focus gefunden: den Körper und die Identität der Frau. Eine Verdichtung dessen stellte Ernst M. Binder mit seiner Collage "Körper und Frau. Eine Entäußerung" her. Juliane Werner setzte sie bei den Gmundner Kulturvermerken in Szene: eine atemberaubende Collage. Einen dichten Kursus dessen, was Jelineks Literatur
bedeutet, gab es am Donnerstag in der Gmundner Hipp Halle zu sehen und
zu hören. Dort begab sich die deutsche Schauspielerin Juliane Werner
als "Claudia" - in Anspielung auf Claudia Schiffer - auf den
hell erleuchteten "Thron", saß da im roten Samtkleid wie
eine verhärmte Venus. Schüchtern begann sie ihren Monolog, endete
bei bissigen aber treffenden Identitätsfragen. In harten Aussagen
rechnet Werner kaum übertrieben und stellenweise brillant mit all
den Scheinidentitäten der Frauen und gesellschaftlichen Zuschreibungen
ab. Ein von Mode, Werbung und Rollenbildern geprägtes Über-Ich
konterte mit einer Stimme vom Tonband. Heftiger Applaus für das etwas
kurze, einstündige Potpourri. |
| trilogie II |
DAS
SCHWEIGEN |
Bühne,
Oktober 2003
BÜHNE: Ihr Text DAS SCHWEIGEN über den gescheiterten Versuch, Robert Schumann zu beschreiben, liest sich wie eine Verarschung von Thomas Bernhards BETON. JELINEK: Ich halte BETON für einen der genialsten Prosatexte von Bernhard. Es geht nicht darum, ihn zu "verarschen". Mich interessieren nur seine McGuffins, wie Hitchcock sie in bezug auf seine Filme erfunden und benannt hat. Also Aspekte, Angelpunkte der Handlung, die nicht weiter erläutert werden, aber um die sich alles dreht. So benutzt Bernhard ja auch Philosophen wie Wittgenstein oder Pascal als McGuffins. Es dreht sich immer um die größten, letzten Dinge (auch z.B. Glenn Goulds Bach-Spiel), aber sie werden immer nur umrissen, angedeutet, treiben die Handlung voran, ohne je erläutert zu werden. Ich habe mich mit einem, der eine fiktive Schumann-Biographie schreibt, sozusagen auf dieses Thema draufgesetzt und es auch ein bißerl parodiert, wenn man so will. BÜHNE: Ernst M. Binder kombiniert DAS SCHWEIGEN mit den von ihnen gelesenen Text DIE ZEIT FLIEHT, einer Hommage an Ihren Orgellehrer. Binder gilt als Spezialist für komplizierte Stücke. JELINEK: Auch Einar Schleef hat Binder ja sehr geschätzt, er war lange Zeit der einzige, der seine Stücke inszenieren durfte. Er hat ein besonderes Verständnis für schwierige Menschen und "sprachlastige" Theatertexte, finde ich. Ich bin ja gespannt, wie er meinen Text über meinen Orgellehrer Leopold Marksteiner da hineinbauen, einmontieren wird. BÜHNE: Wie haben Ihnen die sommerlichen Inszenierungen der österreichischen Politik gefallen? JELINEK: Also das kann vom Theater niemals übertroffen werden, auch vom Kabarett nicht, was sich derzeit politisch abspielt. Ich sitze vor dem Fernseher und lache ununterbrochen, wenn ich die Nachrichten sehe. Die Politik ist in Österreich durch nichts mehr zu übertreffen, deshalb sage ich nichts mehr dazu, es wäre armselig im Vergleich zur Realität. Das Gespräch für
die BÜHNE führte Reinhold Reiterer |
Kleine
Zeitung, 21.10.2003
Schriftstellerin Elfriede Jelinek im Fokus des Projekts "Sprachmusik" im Grazer Literaturhaus. In einen spannenden Sprachsog geriet man bei der gelungenen szenischen Umsetzung des Jelinek-Textes "Das Schweigen - einer dieser vergeblichen Versuche" im Grazer Literaturhaus. Der Monolog eines Schriftstellers, der an seinem immanenten Streben nach dem Ewigen, dem Allumfassenden - im konkreten Fall an seiner Schrift über Robert Schumann - scheitert, wurde von Ernst M. Binder subtil und schlicht im besten Wortsinn umgesetzt. Wohltuende Unaufgeregtheit. Bettina Buchholz gestaltete ihre Rolle witzig und intensiv ohne theatralische Überfrachtung. Dazu passte auch der sensible musikalische Kommentar Josef Klammers, der untermalte, begleitete, unterstützte. Den thematischen Zusammenhalt für den Monolog bildete eine Hommage Elfriede Jelineks an ihren Orgellehrer Leopold Marksteiner: "Die Zeit flieht" ist, von der Autorin gelesen, auf Tonband zu hören. Im Gegensatz zu den andernorts so forcierten Multimediaspektakeln wurde dieser Abend von wohltuender Unaufgeregtheit und literarisch-musikalischer Qualität beherrscht. Eva Schulz |
Salzburger
Nachrichten, 21.10.2003
Auf dem Klavier der Worte und der Stille Erstaufführung in Graz: "Das Schweigen" von Elfriede Jelinek Eine Frau kriecht aus einem Flügel, singt, läßt sich von Geräuschen erschrecken, fühlt sich in der Pause, diesem "Loch in der Zeit", wohl: stille Sequenzen im Literaturhaus Graz. Ernst M. Binder hat zwei Texte von Elfriede Jelinek zusammengespannt: "Das Schweigen", in dem ein Autor versucht, einen Text über Robert Schumann zu schreiben, und "Die Zeit flieht", in dem Jelinek über ihren Orgellehrer Leopold Marksteiner räsoniert. Entstanden ist eine feinsinnig-rhythmische Theatercollage mit aussagekräftigem Untertitel: "Einer dieser vergeblichen Versuche". Für diese Co-Produktion von "dramagraz", "Graz 2003", Landestheater Linz und O.K-Centrum für Gegenwartskunst hat Josef Klammer eine unaufdringliche, aber markante Klanginstallation geschaffen, die aus dem gesprochenen Wort entstanden ist, dieses wiederum unterstützt, verstärkt, mitunter zum Klingen bringt. Ernst M. Binder lässt Bettina Buchholz auf dem Klavier der Worte spielen. Die Zeit flieht und der Schumann-Text ist immer noch nicht fertig. Zu hohe Ansprüche, zu große Anforderungen. Der Körper ein Schmerz und im Kopf dröhnt eine Mahnung: "Rhythmisch bleiben." Mit Spieluhr-Zitaten klingen die musikalischen Monologe aus. Scheitern ist schön. Manchmal zumindest. Martin Behr |
| Kronen Zeitung
- Steiermark, 21.10.2003
Selbstentfremdung im Rhythmus der Stille In dem vierzigminütigen Monolog "Das Schweigen" beeindruckt Bettina Buchholz als zynische Autorin, die von ihren Gedanken geplagt wird. "Sieh deiner eigenen Selbstentfremndung ins Gesicht", sagt Elfriede Jelinek und versucht sich in "Das Schweigen" in den Komponisten Robert Schumann hineinzufinden. Doch sie muss scheitern, denn die Schrift ist nur Schein – nichts ist echt. Das interessante Konzept von Regisseur Ernst M. Binder geht auf: Er umrahmt den sprachlich geschliffenen Text mit der Aufnahme einer Jelinek-Lesung von "Die Zeit flieht", das sie ihrem Orgellehrer gewidmet hat, und zeigt so ein beinahe widersprüchliches Verhältnis von Sprache und Musik. Josef Klammer komponierte aus der Lesung ein kontrapunktiertes Klanggebilde, das das Schweigen zum Klingen bringt: Durch Echo-Effekte verdichtet sich der Monolog zu einem spannenden Rhythmuserlebnis. Bettina Buchholz überzeugt als Bühnen-Jelinek: Zynisch tanzt sie um ein "stummes" Klavier, berichtet humorvoll von den Qualen einer Autorin, geht an der Unbedeutsamkeit der Schrift fast zugrunde. Übrig bleibt ein Wunsch: "Endlich endgültig schweigen zu dürfen, einig mit uns." Tobit Schweighofer |
Kronen
Zeitung - Oberösterreich, 26.10.2003
Jelinek Vorpremiere: Die perfekte Sprachkunst Elfriede Jelinek steht im Mittelpunkt einer Theatertrilogie, die am 18. November im Linzer O.K Centrum uraufgeführt wird. Bei den Kulturvermerken in Gmunden gab es am Freitag eine Vorpremiere: Bettina Buchholz in Bestform! Keine andere als Elfriede Jelinek – gerade mit dem Lessingpreis ausgezeichnet – hat so sehr an der Auflösung des Individuums durch Entpersönlichung der Sprache gearbeitet. Sie entlarvt aber auch die männliche Literaturbeschreibung. In der Trilogie stehen denn auch Frauen und "zur Sprache kommen" im Zentrum. Im Vorjahre präsentierte Juliane Werner Jelineks "Körper und Frau" bei den Kulturvermerken. Heuer kroch Bettina Buchholz in der Gmundner Hipp Halle aus einem weißen, abgeschundenen Klavier und räsonierte in "Das Schweigen" über den Komponisten Schumann, über Biografien, über Schrift und Sprache. Buchholz zog das Publikum mit ihrer perfekten Sprechkunst in den Bann. Ernst M. Binders Regie blieb zurückhaltend. Martin Hornegger |
| trilogie |
/
KÖRPER UND FRAU // DAS SCHWEIGEN /// ALLEINSEIN |
OÖ-Nachrichten,
12. 11. 2003
Vorbericht Elfriede Jelinek schreibt über das Model Claudia Schiffer Regisseur Ernst M. Binder leitet das Grazer forum stadtpark theater (neu: dramagraz). Am 18. November wird im Linzer O.K-Centrum die Trilogie ":Wer will allein sein: eine untersuchung" von Elfriede Jelinek in Binders Regie uraufgeführt. Ernst M. Binder widmet sich vor allem der deutschsprachigen aktuellen Theaterliteratur, wobei er eine Vielzahl an Uraufführungen im In- und Ausland verzeichnen kann. Das Jelinek-Projekt ":Wer will allein sein: eine untersuchung" besteht aus drei Teilen, wobei Teil 1 "eins: Körper und Frau. eine entäußerung" und Teil 2 "Das Schweigen. einer dieser vergeblichen versuche" bereits in Graz uraufgeführt wurden. Nun folgt Teil 3 "Alleinsein. ein tatsachenbericht" in Linz, wo erstmals die gesamte Trilogie mit Juliane Werner und Bettina Buchholz zu sehen ist.
Jelinek-Projekt: Elfriede Jelinek gehört für
mich zu den größten Dichtern und Dichterinnen im deutschsprachigen
Raum. Ich zähle da Peter Handke und Heiner Müller dazu. Diese
drei schreiben Texte, in denen nicht vorgegeben wird, Baron F. trägt
die Kaffeetasse von A nach B, sondern es geht ausschließlich um
den Text. Und das bedeutet eben Auseinandersetzung mit diesem Text, dieser
Sprache. Elfriede Jelinek: Frau Jelinek hat ja eine große
Affinität zur Mode. Sie ist die am besten und extravagantesten gekleidete
Autorin, die ich kenne. Mich hat immer interessiert, welche Frauenfiguren
beschreibt sie? Schauspieler: Es wird an den Theatern immer mehr produziert. Ein Schauspieler muss deshalb in mindestens fünf bis sieben Produktionen gleichzeitig spielen. Da bleibt keine Zeit, auf die Entwicklung des Einzelnen einzugehen. Ich will einen Schauspieler nicht benützen, sondern er soll die Rolle erfüllen, sonst ist er nicht glaubwürdig. Zukunft der Theater: Überall müssen 80 bis 90 Prozent Auslastung sein. Es ist ja schon toll, wenn sich ein Theater eine kleine Bühne leistet, auf der man ausprobieren darf. Die größeren Theater werden sich wohl Produktionsmethoden von freien Theatern aneignen müssen. Es ist idiotisch, am Sonntag nicht proben zu können. Ich verstehe schon, dass alle einen Tag frei haben müssen, aber warum am Sonntag? Gefragt ist Flexibilität. Die Zukunft gehört Projekten, in denen man sich mit Autoren und vor allem Inhalten auseinandersetzt. Freie Theaterarbeit: Eigentlich will ich an dem Kuchen, der ja relativ groß ist für die Staatstheater, schon auch mitnaschen. Deshalb suchen wir auch verstärkt Kooperationen mit größeren Theaterhäusern. Es wird ja leider in der Öffentlichkeit zumeist übersehen, dass das forum stadtpark theater/dramagraz nach dem Burgtheater jenes österreichische Theater ist, das am meisten Einladungen zu Theaterfestivals bekommt. Ernst M. Binder:1953 in Mostar/Ex-Jugoslawien geboren, aufgewachsen in Feldbach/Stmk. Seit 1973 Schlagzeuger bei diversen Bands, dann Autor und Regisseur. Seit 1987 Leiter des dramagraz/forum stadtpark theater. Regisseur vieler Uraufführungen: "Versuch über den geglückten Tag" von Peter Handke, "Es singen die Steine" von Gert Jonke, "Totentrompeten" von Einar Schleef 1995, "Mein Hundemund" von Werner Schwab 1992 u. v. m. Silvia Nagl |
OÖ-Nachrichten,
20.11.2003
URAUFFÜHRUNG: Trilogie
mit Texten von Elfriede Jelinek in Linz Die Trilogie "Wer will allein sein" mit Texten der derzeit bedeutendsten deutschsprachigen Autorin Elfriede Jelinek: Der dritte Teil wurde am Dienstagabend im Mediendeck des Linzer O.K-Centrum uraufgeführt. Teil 1 und 2 dieser Kooperation zwischen Grazer forum stadtpark theater, Landestheater Linz und O.K-Centrum wurden in Graz präsentiert. Erstmals aber ist in Linz nun die gesamte Trilogie zu sehen. Klug, bildreich, mit Raum für Zwischentöne und -gedanken, voll feinen Humors und vor allem so wahr sind diese Texte der Wiener Autorin, die Regisseur Ernst M. Binder zu einer homogenen Bühnenfassung montiert hat. "Wer will allein sein" bestehend aus den Teilen "Körper und Frau", "Das Schweigen" und "Alleinsein": Ein Lehrstück auch darüber, wie perfekt und prononciert Text vorgetragen werden kann. Die in Berlin lebende Schauspielerin Juliane Werner und die am Landestheater Linz engagierte Bettina Buchholz haben gezeigt, wie deutlich und eindringlich Bühnensprache sein kann - und soll. Und haben dadurch diesen Abend zu einem faszinierenden und fesselnden Ereignis gemacht. In Teil 1 schillert Juliane Werner facettenreich beim Monolog eines Unterwäschemodels namens Claudia, das in einer Klomuschel Zuflucht vor einer schönheitsbessenen Scheinwelt sucht. Teil 2, "Das Schweigen", über die Mühen des Schreibens und Komponierens und die Angst vor dem Versagen, eindrucksvoll umgesetzt von Bettina Bucholz. Respekt auch vor der Textsicherheit der Schauspielerinnen bei diesen stellenweise sehr massiven Textgebirgen, bei denen die Zuhörerschaft ebenso gefordert ist. Ernst M. Binder lässt durch eine minimalistische Regie die pure Konzentration auf den Text zu, vermeidet Bedeutungsschwere, und entspricht diesen immer auch wortverspielten Sprachbildern in ihrer tänzelnden Sprachmelodie. Teil 3, "Alleinsein": Ein analytischer, ironischer, ja sarkastischer Text über Frausein, den Werner und Buchholz - in Dirndl und Bergschuhe gezwängt - vortragen. Adrette Mädels, genau so, wie Frauen eben gerne gesehen werden. Kompliment an das Publikum, das zweieinhalb Stunden derart konzentrierte Stille bewahrte, als ob es derzeit keine Schnupfennasen gebe. Silvia Nagl |
Neues
Volksblatt, 20.11.2003
Ein Abend der Konzentration Elfriede Jelinek, die als Protest gegen die schwarz-blaue Regierung ihre Werke einst nicht länger an österreichischen "Staatstheatern" aufgeführt sehen wollte, wird mittlerweile auch hier zu Lande mehr denn je gespielt. Im Mediendeck des Linzer O.K kam am Dienstagabend - als Kooperation mit dem Landestheater - ihre Trilogie ":Wer will allein sein:" zur "halben" Uraufführung, denn Teil 1 ("Körper und Frau") und Teil 2 ("Das Schweigen") waren bereits in Graz bzw. Gmunden zu sehen. Regisseur Ernst M. Binder ist mit den hervorragenden Darstellerinnen Juliane Werner und Bettina Buchholz ein konsequenter, stimmiger Abend gelungen: Mit sparsamen Mitteln und höchster Konzentration der Protagonistinnen forderte Jelineks monologisches Kreisen um weibliche Selbstwahrnehmung und Körperbewusstsein, Entfremdung und die dem Schriftstellerdasein innewohnende Gefahr des Scheiterns oder auch die aktuelle "Aufladung der Gegenwart mit Männlichkeit" beim zahlreich erschienenen Publikum volle Aufmerksamkeit und Anerkennung. Birgit Thek |
Krone
Oberösterreich, 20.11.2003
Jelinek-Trilogie im O.K: Bezwingender Rhythmus Jelinek-Texte sind schwierig? Sperrig zu lesen? Vergessen Sie diese Vorurteile, kaufen Sie sich eine Karte für die Jelinek-Trilogie :WER WILL ALLEINSEIN: im Linzer O.K Centrum, lauschen Sie dieser Sprachmelodie, deren Rhythmus sich bezwingend in die Ohren legt, deren (Wort-) Witz bisweilen großartig ist. Zu schauen gibt es wenig. Juliane Werner in rotem Samt gehüllt, ein altes Klavier spuckt Bettina Buchholz aus, kaltes Neonlicht – mehr Futter gibt Regisseur Ernst M. Binder den Augen nicht. Was hier zählt, ist das Wort, sind viele Wörter – großartig bewältigt von den beiden Darstellerinnen. Keine Minute möchte ich missen! Milli Hornegger |
Die
Presse, 20.11.2003
Zwei Mädel im Dodelland (Kl)eine Jelinek-Uraufführung in Linz: "Wer will allein sein", eine Trilogie über Frauen und Künste. Elfriede Jelineks rasanter Texte-Webstuhl bringt kontinuierlich Früchte hervor, die nicht für die Bühnen gedacht sind. Mit klassischen Theatermitteln (Gestik, Mimik, Bewegung, Sprechen), und ohne viel Aufwand, kann sie jede Kellerbühne auf die Reise schicken zu einem Publikum, das vielleicht dicke Jelinek-Romane kauft. Doch an den vielen luziden kürzeren Texten, alles Gene eines einzigen Lebensopus, geht der Buchhandel vorbei. Die Dichterin stellt sie laufend und kostenlos ins Netz (http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede). "Bambiland", ihre Spontanreaktion auf den Irakkrieg, seit Frühjahr im Internet, hat am 12. Dezember in Christoph Schlingensiefs Regie im Burgtheater Premiere. Das Linzer Landestheater lockte am Dienstag ins "O. K. Centrum für Gegenwartskunst" zur "Uraufführung" der Trilogie "Wer will allein sein". Teil I, "Körper und Frau", mit einer an Claudia Schiffer erinnernden Monologrolle, brachte Ernst A. Binder schon in Graz heraus - freilich durch Einsprengsel aus Stücken wie "Todtnauberg" verschlimmbessert. Teil II, "Das Schweigen" (Jelinek vom Band über ihren Orgellehrer Marksteiner und ein Monolog über Künstler als Weltschöpfer und -versager) sahen schon Gmunden und Graz. Der neue Nachschub, "Alleinsein", macht den Jelinek-Abend nur länger, doch nicht besser. Auch dieses Viertelstündchen füllt ein famoser, perlenreicher Lesetext: feminines Grübeln über ödipale Ursachen von Männerkrieg, Fundamentalistenterror, islamischer Frauenverhüllung etc., gewidmet Jutta Limbach, vormals Präsidentin des deutschen Bundesverfassungsgerichts, nunmehr Präsidentin der Goethe-Institute. Man darf ihn als Verständigungsakt zweier illusionsloser, weltbewusster Frauen lesen. Doch Ernst M. Binder zerrt ihn herunter zum Dodelspiel in einer klischeehaften Alpenprovinz. Juliane Werner und Bettina Buchholz (in den Soloparts davor akustisch betörend) ziehen in Dirndlkleidern, die Beine in Bergschuhen, die frauenstammtischreife "Wir armen Weibchen"-Nummer ab - unter rotweißrotem Licht zur einmal militärisch geblasenen, ein andermal von Mädchen gehauchten Bundeshymne. Brrrr. Hans Haider |
DER
STANDARD, 25.11.2003
Trilogie der Entäußerungen Zwei bekannte und ein neues Stück von Elfriede Jelinek im Linzer O.K Centrum Linz - Die optische Verwandlung von der in hochgeschlossenem Samt und strengem Scheitel reglos auf dem Thron sitzenden Prüden zum Unterwäschemodel, dessen anderes Ich aus der Klomuschel murmelt, korrespondiert keineswegs mit einer Versinnlichung des Geschehens: Unnahbar sind sie beide, bleiben eingebettet in einen Kokon des Selbstschutzes. Körper und Frau - sie suchen sich im durch männliche Außenblicke durchbrochenen Spiegel. In einem Dialog, der wie ein rhythmischer Sprachstrom aus dem zunächst natürlichen, dann lippenstiftbewehrten Mund der großartigen Juliane Werner strömt, eruptiv, dann wieder listig unterspülend. Ein inhaltlich-formal genial verwobener Text in der punktgenauen Inszenierung von Ernst M. Binder. In Linz wurde er nun im Rahmen einer Koproduktion des Landestheaters mit dem O.K Centrum durch Das Schweigen und die Uraufführung von Alleinsein ergänzt und zu einer Trilogie der die Außenwelt kommentierenden Entäußerungen verbunden. Die Stimme der Jelinek durchbricht vom Band das Schweigen, elektronisch virtuos dekonstruiert von Josef Klammer, bevor Bettina Buchholz einem Flügel entsteigt und Robert Schumanns Schöpfungsqualen ironisch unterläuft: "Irgendwann muss er aufstehen, das Schöne als noch schöner empfinden, das Schreckliche als noch schrecklicher, und dann soll er es gefälligst gefällig ausdrücken . . ." Um dann zu entdecken, dass Schöpfertum und Leben einander ausschließen, dass Sonne und Regen nur den Vergessenen jene spontanen Selbstgefühle schenken, die ohne fremde Filter durch die Haut dringen. In Teil drei schließlich kommen Juliane Werner und Bettina Buchholz in Dirndl und Bergschuhen auf das Podium, um das Umfeld des unfreiwilligen Alleinseins selbst-bewusster fraulicher Entäußerungsversuche sarkastisch zu durchleuchten. Immer ganz nahe an der politischen Analyse und doch voll poetischer Sogkraft. Sehr subjektiv verletzt von Krieg und Terror, Vatermord und Mutterschändung. Ein Kosmos der Gewalt, der doch leer ist, keine Sprache aufnehmen kann und die Sprechenden allein lässt. Reinhard Kannonier |
| TEXTE zur Trilogie : WER WILL ALLEIN SEIN : |
| VON
ELFRIEDE JELINEK
Man spricht nicht einfach wie man spricht, sobald man schreibt. Es treibt einen dazu, mit oder ohne Begeisterung, über sich hinauszugehen und gleichzeitig auf sich zurückzuschauen. Ohne immer genau zu wissen, was man da schreibt. Österreich. Ein Wintermärchen
|
| zurück zur Übersicht Texte |
| Körper
und Frau
Claudia (Aus einer verschlossenen Klokabine, vom Band, Computerstimme): (Stöhnen) Glühendschön mein Körper in der Muschel, wie soll ich ihn noch mehr loben? Er entsteigt. Ich und mein Körper gehören zusammen, und jetzt will er plötzlich weg aus der Muschel, will leben, will fort vom Ruf, der Gestalt annimmt, will weg von den Düften, die von meiner Persönlichkeit ausgerufen werden. Bleib, du Körper, bleib bei mir! Gut, du gehst fort. Aber nicht ohne mich, sonst müßte ich ja auch gehn. Ich habe was Zwingendes an mir. Bleib! Ihr mit dem frischen Aussehn, das mir nacheifert: Seid nicht so schön wie ich! Ich: sei schöner! Ohne meinen Körper wäre ich nicht mehr da. Darin besteht ja gerade meine Persönlichkeitsstruktur. Sei in mir zu Hause, Körper, nein, umgekehrt, sei in deinem Körper total zu Hause, Claudia! Bleib, Claudia! Bleib, Körper! Diese schöne Muschel, der ich Venus entsteige, nachdem ich sie mit Mut bestieg, in ihr will ich mich und meinen Körper miteinander denken lassen. Zu zwein. Dürfte ich mit dir vielleicht einer Meinung sein, Körper? Ich speichere Worte in dir. Ich speichere Kleider auf dir. Geh nicht fort! Bitte schließen auch Sie die Tür nicht vor mir! Sonst haben Sie nämlich keine Chance mehr, mich und Körper zu sehen! Denken Sie nicht nur an mich, denken Sie auch an mein Werk, bitte! Ich habe mir doch dieses tolle Haus auf Mallorca bauen lassen, damit ich meine Probleme hineinlegen kann. Ich habe keine Probleme. Man braucht meinen Körper nicht, um dieses Haus schön zu finden, über Ungeschicklichkeiten an seiner Fassade sehen Sie bitte hinweg. Schön mein Körper, der sich zeigt, der Muschel entsteigt, wie eine kaum vom Nebel verschleierte Gegend. Finden Sie nicht? Aber hallo. Hier wird nicht besetzt, hier ist besetzt! Hallo! Hochpolitisch mein Denken, hochgradig nervös mein Handeln, hochmodern meine Kleidung, Hochleistung mein Körper. Der gibt was her. Der gibt nichts her. Es ist ein Zusammenspiel von mir und ihm. Ich setze alles dran, ihn zu befreien, aber nur, um ihn behalten zu können. Schauen Sie mein rosa Höschen und den rosa BH an, ich wollte, sie verhielten sich anders zu mir, erweiterten meine Figur zu etwas Nettem, damit jede Frau glaubt, sie hätte es auch, wenn sie nur wollte. Die Menschen fürchten mich und sind scheu vor mir, dabei bin ich das Anschauensallerwerteste! Mein Mund sagt verächtlich etwas dazu. Meine Körperteile gehören zusammen und spielen gemeinsam wie die Fohlen und die Zicklein, sie spielen genau soviel wie die Hände tragen und die Augen fassen können. Dann hören sie wieder auf. Das ist wie beim Bauen, nur alle Ziegel gemeinsam. Körper, du bist lediglich meine Grabbeigabe, das Wesentliche bin doch ich mit diesem Stück insgesamt Körper: eins kommt ohne das andre nicht aus. Brüste haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen, na, meine nicht, Beine haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen, na, meine nicht, das Haar hat grundsätzlich immer mit Schwierigkeiten zu kämpfen, na, meins nicht. Ja. Schauen Sie nur genau hin! Meine Körperteile können sich so oft sehen lassen wie sie wollen. Millionenfach. Viele Frauen glauben, es wären ihre, aber es sind meine. Ich muß diesem Gesellschaftsmitglied hier leider mitteilen: Alles was Sie sehen gehört einer andren: mir! Sonne Wind Wolken Meer also da liegt kein Felsblock auf meinem Mund. Es ist dieser Frauenmund hier, und die Öffentlichkeit ist sein bester Zuhörer. Zaghaft geschwungene Oberlippe, einig mit der einladenden Unterlippe, ja seid ihr denn blind, meine Zähne, daß ihr eure eigene Größe so gar nicht fassen könnt! Sie Frauen tun mir leid, weil Sie Ihre Lippen, Ihre Augen, Ihre Haare nicht dermaßen zuschleifen können wie ich meine. Es setzt von Ihrer Seite her ein Vergleichen ein, doch ich muß mich dem gar nicht erst stellen. Ich stehe ja schon fest. Sie tun mir leid. Tut mir leid, ich bin meinem Körper zugewiesen worden, aber ein andrer Körper hätte mich gar nicht erst genommen. Ich wäre ihm wahrscheinlich zu schön gewesen. Nur dieser Körper erhielt den Zuschlag. Er bleibt bei mir, er gehört mir, das ist sicher. Ich lasse ihn fotografieren, damit ich beweisen kann, falls er wegrennt: er gehört zu mir und darf sich jederzeit gehen lassen. Aber nicht weglaufen! Jetzt hängt er z.B. grade in der U-Bahnstation, wo Sie immer einsteigen, und er hat diesen BH und dieses Höschen an. Brauche ich ihn noch, diesen Körper? Wo er hängt, hängt er ja gut. Doch, ich brauche ihn noch. Was Sie von mir sehen, ist schon alles. Zurzeit sehen Sie mich nicht. Besetzt. Hier ist besetzt. Über mich hinaus ist nichts und passiert nichts. Leere und daß ich mich amüsiere füllen den Raum mit Nebel. Ich habe dieses Parfüm selber kreiert. Etwas Billigeres können wir uns nicht leisten. Mein Herr Körper, mit dem ich mich vorhin noch amüsiert habe, will jetzt wieder berufstätig sein. Ich lasse ihn nicht fort. Er kann auch hier arbeiten. Er ragt in den Raum hinein, zeigt sich vor. Er verzehrt alles, was an anderen Menschen vielleicht eigentümlich aussehen könnte und sie ziemlich problematisch erscheinen lassen würde. Hilfe, mein Körper schlingt mich jetzt viel zu schnell runter! Mir wird schlecht, nein, umgekehrt, ihm wird von mir schlecht. Ich werde von meinem Körper verzehrt! Hilfe! Hätte ich ihn doch weggelassen! Nein, das hätte ich nie getan. Er will nichts über sich hinaus, ich aber will ein Betriebswirtschaftsstudium beginnen. oder eine Schauspielerinnenkarriere. Oder beides zugleich, er will immer wieder beginnen, damit er zu einer eigenen Persönlichkeit ausgerufen wird, die er dann prompt findet, wie ein Osterei. Oh, eine Erzählschwierigkeit, geh sofort weg da! Ich rede jetzt! Ich will jetzt reden! Hier ist besetzt! Bitte nicht nochmal! Bitte nur einmal mich, bitte nicht mich wiederholen! Seien Sie eine andre, seien Sie nicht ich. Mich gibt es ja schon! Was mein Körper da bereits verschlungen hat, eine ganze Menge, leider hauptsächlich von mir, aber er gibt auch was her! Wie schön mein Blick, wie supertoll heute wieder mein Haar! Ich glaube, ich muß mich selbst wieder auskotzen, damit Sie mich noch einmal sehen können! Guten Tag. Damit Sie wissen, wie ich im Innersten bin, kränkelnde Zartheit vielleicht, gesunde Robustheit sicher, egal, Sie werden niemals so sein. Warum erwarten Sie vom Körper, daß er wie ein Gebirgspanorama funktioniert, daß er schön und dabei doch so natürlich aussieht wie es nur die Natur selbst fertigbringt? Das wärs. Sie sind meine Konsumentin. Jemand andrer ist meine Kosmetikerin. Verlassen Sie ruhig und ohne Bedauern Ihre Kleidung, betreten Sie das Geschäft und kaufen Sie sich neue. Es nützt Ihnen nichts. Bestellen Sie sich ruhig meinen Körper, Sie werden sehen, er wird mit Ihnen nicht mitgehen wollen. Sofort loslassen! Das ist meiner! Jaja. Sie können ruhig auf diese Türschnalle drücken, um ihn sich zu holen, Sie werden sehen, die Tür geht nicht auf. Es ist ohnedies besetzt. Der Körper ist nicht dazu da, damit hereinspaziert werden kann. Ich bin ja drin! Es ist Ihnen doch nicht egal, daß dieser Körper mir gehört, oder? Also mir ist es nicht egal. Ich gebe ihn nicht her. Und ich bin immer verschwunden, sobald Sie mich zu Hause auspacken wollen. Nur dürres, glattes Papier, vielleicht noch mit einem Astloch, damit Sie den Durchblick haben, einen entsetzlichen Augenblick des Erschreckens, daß Sie dort drinstecken, mehr ist nicht drin. Mehr ist nie drin. Und selbst das ist Täuschung, denn nur ich bin drin. Das werden Sie schon noch merken. Ich sehe, Sie nehmen mich trotzdem mit. Nicht von hier! Von hier kriegen Sie mich nicht raus. Hier ist besetzt. Ich bin immer eine andre, als Sie gedacht hätten. Auseinander, Sie Frau! O je, mein Bild ist diesmal ziemlich flach ausgefallen. Wenn Sie es trotzdem haben wollen, bitte. Aber hier ist besetzt. Mein Körper gehört mir. Ihr Körper gehört Ihnen nicht, er gehört jetzt auch mir. Also nein, bei näherem Hinsehen merke ich doch: den können Sie behalten. Er würde unter meinen Blicken zerbrechen und welken, sobald er mich als seinen ewigen Spiegel erkennt. Ich bin in Einzelteilen auf dieser weiten Plakatebene ausgelegt, schlank wie immer komme ich Ihnen entgegen, aber nie weit genug. Unaufhörlich rast der Wind über diese Ebene. Jetzt haben Sie sich diesen BH gekauft, für streichelnde Menschenhände, aber die wollen nur mich streicheln. Mein Körper kann von mir aus ruhig ausgelegt werden, es traut sich doch keiner darüber hinwegzutrampeln. Er kann auch gegessen werden. Er ist der einzige Kuchen, der gegessen werden, aber von mir behalten werden kann. Sie haben keinen Anspruch. Jeder hat einen Anspruch, aber dieser hier ist besetzt. Keiner kommt durch. Diese Tür hütet mich. Mein Herr Körper ist das, was hineingekommen ist und jederzeit herauskommen kann, doch er will nicht. Er darf nicht. Sie kommen hier nicht hinein. Sie haben einen Anspruch, aber Sie kommen mir hier nicht herein. Mein Herr Körper ist der, der nichts durchläßt und der, der vorhin als erster schon dagewesen ist und sich irrtümlich in mir eingesperrt hat. Jetzt muß er bleiben. Er muß nicht mehr kommen. Er muß dableiben. Eintretende werden ja oft geschlossen, bevor sie noch die Tür ins Leben gefunden haben. Ich bin ohnedies da. Ich geh hier auch nicht weg. An jeder Frau ist mehr kaputtzumachen als an mir. Bleiben Sie draußen. Hier ist besetzt. Ich bin unartig und stelle mich selbst in den Schatten. Sie sehen mich trotzdem. Sie sehen mich nicht. Sie sehen nur mich. Hier wird von mir besetzt gehalten. Ich reise in der ganzen Welt umher, aber hier ist und bleibt von mir besetzt. © 1999 Elfriede Jelinek Der Text "Körper
und Frau" wurde zur Eröffnung des Schauspiel Frankfurt unter
der Intendanz Elisabeth Schweeger geschrieben. Die in das Stück montierten
Texte Elfriede Jelineks stammen aus "Der Wanderer" (1998), "Totenauberg"
(1991), "Sportstück" (1998) und einem Essay der Autorin
zum Thema "Mode" in der Süddeutschen Zeitung (2000). |
| zurück zur Übersicht Texte |
| Die
Zeit flieht
für meinen Orgellehrer Leopold Marksteiner Ich war noch sehr jung, als ich bei Leopold Marksteiner ein Orgelstudium begonnen habe. Ich war dreizehn Jahre alt. Für das Kind, das ich ja noch war, aus komplizierten, belastenden familiären Verhältnissen kommend, die es damals und wahrscheinlich bis heute nicht abstreifen konnte, ist es sehr schwierig gewesen, diesen eigentlich für Erwachsene gedachten Unterricht eines großen Meisters allein psychisch überhaupt durchzustehen. Für die Aufnahmsprüfung hat man mich, die ich darauf gar nicht vorbereitet war, aus meiner Schulklasse herausgeholt. Irgendwie hat man da dauernd überlastete Sicherungen, es ist, als würde das Wesen total überfüllt mit Informationen, die einen suchen, und vor denen man gleichzeitig, um sich zu retten, fliehen muß, weil man sonst durchknallt von all dem vielen Strom, der durch einen hindurch- schießt. Paradox. Als wäre die Musik (bei mir dann später, sozusagen als Endstation: die Sprache) die Erde, auf der man geht, aber vor diesem Grund, auf dem man sich bewegt, möchte man immer wieder davonlaufen, was naturgemäß nicht möglich ist, weil man ja sonst ins Bodenlose stürzen würde. Man geht also auf etwas herum, auf einem Grund, vor dem man flüchten möchte, was eben unmöglich ist. Aber was man tut, während man suchend auf den einen, so sehr gesuchten Ort zugeht, den man aber nie findet (man steht ja drauf!): man bleibt fremd. Weiß aber nicht warum. Denn das da unter den Füßen, das sieht man nicht. Es wird von einem selbst verdeckt. Ich glaube, auch wenn dem Professor, damals selbst noch ein junger Mann, der sicher wenig Erfahrung mit Kindern gehabt hat, diese fundamentale Fremdheit seiner Schülerin bewußt gewesen ist (und die Musik wiederum, die schon seit vielen Jahren, seit frühester Kindheit, von ihr, der Schülerin, ausgeübt worden war, war ja einer der Hauptgründe für diese Fremdheit - allein die völlige Verständnislosigkeit der schicken Mädchen der sechziger Jahre in ihren Partykleidern, mit ihren aufgetürmten Frisuren und Bleistiftabsätzen gegenüber einer zum Orgelunterricht eilenden Schulkollegin, die womöglich noch Geige und Bratsche und eine schwere Notentasche an sich irgendwie angebracht hatte! In diesem Alter ist das wie ein Riß durch die Welt, die sich eh schon zu schnell dreht und der man, wie gesagt, eben nicht davonlaufen kann), so hat er doch, in einem guten, im besten Sinn des Wortes, darauf nicht geachtet. Oder jedenfalls nicht so, daß ich es gemerkt hätte. Daß ihm das alles vollkommen klar gewesen ist, hat er mir erst viele Jahre später gesagt. Er hat damals jedenfalls seiner Schülerin einen Ort angeboten, an dem die Welt zwar auch nicht langsamer war, an dem man ihr aber etwas entgegensetzen konnte: eine Hörbarkeit des Zeitablaufs. Das, was Musik ist. Ich meine nicht das gurgelnde Verschwinden von Zeit im Abfluß des Radios, des Plattenspielers, später des CD-players, sondern Zeit, die man, in ihrem Verlauf, hören konnte und gleichzeitig selber steuerte, Zeit, die man, in ihrem Ablauf, sorgfältig gliedern mußte, damit man sie nicht verlor (rhythmisch bleiben! Wie hat mich Leopold damit geschunden! Was an der einen Stelle weggenommen wird, das muß an der anderen wieder dazugegeben werden, sonst fällt alles um). Ich bin beim Spielen ja unentwegt immer schneller geworden, als wäre mir mein eigener Pulsschlag vorausgeeilt. Da hat der Professor mich entschlossen, und manchmal mit etwas scharfen Worten, wie soll ich es sagen: eingebremst. Das ist ihm allerdings einmal nicht gelungen, weil er halt nicht neben mir gestanden ist, als ich im Mozartsaal Messiaens „les yeux dans les roues" gespielt habe, in einem Affentempo, bei dem nun ich ganz allein, an seiner Statt, dann buchstäblich neben mir gestanden bin und mir entsetzt bei meinem grausigen Höllengalopp zugeschaut habe, keine Ahnung, wohin ich wollte, aber jede Sekunde habe ich erwartet, diesmal das Ziel zu verfehlen, buchstäblich ins Nichts katapultiert zu werden und mir womöglich dabei selber auch noch entgegen- zukommen, nach dem Verlassen des Raum-Zeit-Kontinuums, na, physikalisch ist das jetzt sicher ein Blödsinn, und außerdem übertreibe ich. Aber damals habe ich immerhin bereits von Anfang an viel zu schnell losgelegt und durfte natürlich, ich wollte ja des Lehrers Ratschlag zu befolgen suchen, diesmal wiederum nicht langsamer werden. Mitgefangen, mitgehangen. Die Musik, die ich ja selbst auf dem Instrument erzeugte, lief neben mir her und schnappte ab und zu böse nach meinen Waden, welche, im Davonlaufen, entsetzt die Pedale traten. So kehrt sich Geschaffenes manchmal nicht nur gegen seinen Schöpfer, sondern auch gegen den Mechaniker, der es zum Laufen bringen soll. Aber doch bitte nicht so schnell! Ich sagte mir, du mußt es können und du wirst es, nein, umgekehrt, du wirst es können und du mußt es. Daß ich beim Abgehen laut „Scheiße" gerufen habe, das sage ich hier nicht, das kann der Leopold selber erzählen, wenn er will. Da können wir sie also vom laufenden Meter abschneiden, die Zeit, die sich gleichzeitig dem eigenen Ablauf, dem Ablauf derselben Zeit, entgegenstellt, sodaß man für einen Moment glauben kann, zur Ruhe gekommen zu sein, aber das ist dann nur der Augenblick der gebündelten Energie, wenn die Zeit, die man erzeugt, mit der Zeit, in der man lebt, in eins zusammenfällt. Wie einer, der geht und sich ausruhen möchte, das aber nicht kann, weil er merkt, daß er die ganze Zeit schon dort war, wo er ankommen wollte, und, anstatt daß er endlich sein Jausenpaket auspacken kann, entsetzt von seinem Sitz aufspringt. Zufriedenheit im Ausruhen gefällt der Musik nicht. Nein, man kann sich in der Musik nie ausruhen, weil ja auch in den Pausen immer das ganze drinnensteckt. Die Pause ist ein Loch in der Zeit, und die Zeit bleibt, wie gesagt, nie stehn. Sie läuft zwar in zwei entgegengesetzte Richtungen gleichzeitig, aber stehen bleibt sie nicht. Die Musik. Etwas, genau diese Zeit, bewegt sich in einem, auch wenn sie einmal innehält, und man ist gezwungen, immer nur auf den einen Ort zuzugehen, wo man diese Bewegung in sich, während man selber auch arbeitet, aber sich dabei nicht von seinem Platz fortbewegt, wo man also diese Bewegung, die in einem herumrast, daß es einen fast zerreißt, konservieren kann, aber nicht um endgültig zur Ruhe zu kommen, sondern um in dieser Bewegung, Bewegung im Stillstand, bleiben, ausharren zu können. Musik macht einen fremd, obwohl ja alle dauernd Musik hören, der eine dies, der andre das, man kann sich ja kaum vor ihr retten, sie ertönt einfach überall, manchmal fast nur noch als Wummern von Bässen, und trotzdem: wenn man sie selbst erzeugt, die Musik, wird man dabei, auch für sich, gleichzeitig etwas Fremdes, nicht so fremd, wie die Komponisten es gewesen sind, aber doch, denn ihren Rufen folgt man schließlich, und wohin sie einen locken, das sollte man wissen, wenn man ordentlich geübt hat (o je!), aber wenn wir dort angelangt sind, dann bricht eben auf einmal dieser Boden unter uns ganz weg, wir sind selber ganz weg, und wir wissen, daß wir nicht mehr gemütlich unter uns sind, sondern daß das, was unter uns ist, sich bewegt - wie die Zeit. Keine Rettung. Danke für diese Erfahrung an Leopold Marksteiner. © 1999 Elfriede Jelinek Aus einer Festschrift zum
siebzigsten Geburtstag Leopold Marksteiners. |
| zurück zur Übersicht Texte |
| Das
Schweigen
Schauen Sie, wie kann der erwachsene, alleinstehende Mensch in seiner natürlichen Trägheit im Schreiben wirksam werden? Wie schön und still ist es zur Zeit noch in ihm und um ihn. Aber nicht mehr lang. Irgendwann muß er aufstehn, das Schöne als noch schöner empfinden, das Schreckliche als noch schrecklicher, und dann soll er es gefälligst gefällig ausdrücken. Also, da hält er jetzt endlich was umschlungen und verfaßt seine Schriften, die aufgehn sollen, sobald ihr Same im Beet feststeckt. Gut. Das Beet ist voll. Was ist das Problem? Diese Werke, sie sind, obwohl dicht gesät und überhaupt toll, doch irgendwie gleichzeitig leer und voller Irrtümer. Ich sage großartig: mein Werk über Schumann wird das einzig mögliche sein. Es wird das einzige bleiben. Es wird das Bleibende bleiben. Und dann sage ich lange gar nichts mehr. Jetzt soll ich also dem Geistesschlaf von diesem Menschen auch noch etwas Farbe geben! Ich verlange es von mir. Irgendwas muß ich ja tun, um mir gerecht zu werden. Zu niemandem bin ich so gerecht wie zu mir. Indem ich Schumann gerecht zu werden suche, bin ich gerecht zu mir. Ich muß mir dieses Werk abringen, weil es mich sogar im Schlaf noch würgt. Und das Werk soll dann auch noch von allein stehen können, in einem Bücherregal, in der Ewigkeit, in einem Haus, an einem langen Sonntagnachmittag im Bett, am kürzeren Ende eines Asts. Und sobald es das endlich kann, soll es auch schon fürs Ganze stehn und fürs Einzige über den Komponisten Schumann gelten, den Sie sicher von etlichen Radiosendungen und CDs kennen. Umso schlimmer. Wahrscheinlich werden Sie darüber hinaus gar nichts mehr erfahren wollen. Das kommt noch dazu. Die Musik wird Ihnen völlig genügen, sie ist ja das Genügsamste, sie braucht nur etwas Strom und ein paar Geräte. Ich werde sagen: meine Schrift über Robert Schumann, und Sie werden sofort wissen, was ich meine. Ich sage: meine Schrift, und ich sage meine Schrift über Schumann. Obwohl ich kaum Noten lesen kann. Was ich nicht sage. Schon herrscht die Stille, erwartungsvoll, die Stille, die Sie nicht kennen, weil sie natürlich bei Ihnen nie herrscht, also bei mir darf sie es: herrschen. Nicht solange sie will, aber zumindest solang bis das Wort kommt, Achtung, jetzt kommts! Nichts kommt. Kein Wort. Alles bleibt still. Welch ein Verlust! Wäre es gekommen, es wär ein gutes Wort gewesen. Also ich befreie jetzt das Wort von seinem Kommen. Vielleicht kommts dann schneller, wenn es nicht kommen muß. Nein, wieder nichts. Hinsichtlich Schumanns muß ich nicht einmal die Worte Wahnsinn, Klavier, Kinderszenen, Sonate, Clara aussprechen. Es genügt zu sagen: meine Schrift über Robert Schumann. Und damit habe ich auch schon den Durchbruch durch eine Mauer unverständigen Schweigens erzielt. Hab mich recht elegant durchgezwängt durch die finstren Möbel, die andre aufgestellt haben, in deren Staub sie mit dem Finger Kringel, Ziffern, Wörter gemalt haben. Durch das Unwesen von andren, das es in einem hübschen Park lustlos mit sich selbst treibt. Dort bin ich auf einer Bank gesessen und hab es beobachtet, bis eine junge Mutter die Polizei gerufen hat. Ich habe mir doch keine Freiheiten herausgenommen! Was ich mir erlaubt habe, war nichts als ein Rückwurf auf mich selbst. Eine Freiheit gegen mich, also äußerste Unfreiheit, verhängt über mich. Denn wo Schumann draufsteht, bin jetzt ich drin. Schumann raus, ich rein! Ich strebte also in Richtung Schumanns, bitte, da ist ja schon seine kleine Statue, hier meine Schrift, dort ist mein hoher Status, grüß Gott, Sie auch da? Eine kleine Menge von Lesern folgt mir erwartungsvoll und erbarmungslos, sie erwarten sich natürlich einiges von mir, bloß um mir endlich zu widersprechen, und wärs nur bezüglich dieses Komponisten, der einige von ihnen interessiert , die anderen aber nicht. Doch alle, alle wüßten Besseres zu sagen, egal über wen. Schauen Sie sich diesen Anfang an - eine einzige Verweigerung! So kann keiner angefangen haben. Ich begann trotzdem zu schreiben. Die Haushälterinnen kamen und gingen, schweigend, niemand sonst darf da sein und sprechen, wenn ich schreibe. Auch wenn ich nicht schreibe, darf keiner, außer mir, sprechen. Ich begann also. Ich kam und ging, sprechend, und nur über einen einzigen schweigend: Schumann. Schweigend, indem ich nichts tat als über meine Schrift zu sprechen. Doch es genügte, um den Namen Schumann zu verschenken, wie ein Handy, das man in der Zeitschrift gewinnen kann, zusammen mit der Anmeldegebühr, daß man an den Gesprächen überhaupt teilnehmen darf. Ich baute mich als Werk also recht nett rings um Schumanns Werk herum auf und möblierte mich; wo sind die Blumen, so, fertig! Schon können Sie Ihre eigenen Beobachtungen über Schumann machen und meinen sofort widersprechen. Alle Beobachtungen, egal welche, werden von mir naturgemäß sofort wieder verstellt. Ich bin ja größer als sie. Nein, ich rücke nicht beiseite, das ist nicht nötig. Schumann sollte in meiner Schrift, die da kommen sollte, sozusagen das Kommendste überhaupt werden. Doch dann kam er nicht. Auch nicht als ein Teil von mir. Das schon gar nicht. Er kam einfach nicht. Da war nichts zu machen. Vielleicht hatte ich mich in der Ankunftszeit geirrt. Er war was er war und wofür allein sein Name gebürgt hat, höchste Qualität. Anerkannte Qualität. Man kann sagen, ich bin kein Freund Schumanns, ich bin eher ein Freund von Brahms und Schubert, aber ich bin ein Freund von Qualität. Aus diesem Grund bürge ich doch für ihn. Ich bürge nur für die allerhöchste Qualität. Sonst kann ich für niemanden bürgen und für nichts garantieren. Einer der größten Komponisten ist er, uns allen gegeben, damit wir die Wächterschaft über ihn übernehmen, daß keiner was Falsches über ihn sagt. Und ich der Wächter über die Wächterschaft. Sprechen darf grundsätzlich jeder, weil jeder es kann. Auch ich tu ja nichts anderes. Kann man sagen, ich habe Schumann benutzt, um ihn, gerade indem ich über ihn redete, vollständig auszusparen? Das wäre dumm, bei all der Mühe, immer nur mich selber niederzuringen, Einbrecher und Wächter in einer Person. Ich soll über ihn geredet haben, damit ich nicht über ihn reden mußte? Es ist, als ob die Armut verarmen, der Reichtum endlich wirklich reich werden müßte. War die Menge mir noch bereitwillig bis zu mir gefolgt, die Leute sind ja immer neugierig, wenn sie sehen können, wie einer lebt, Möbel und so, ein Landgut, ein Mercedes Diesel, bis zu mir war sie mir also gefolgt, die Menge, wie sie vorgab, nur um Schumanns Einzug in mein Werk mit mir, auf mir, in die Öffentlichkeit zu tragen. Um sich dann sofort daneben zu stellen, damit man sie nicht übersieht. Denn dort, neben die Großen, dort gehört sie hin, die Menge, die sich für verständig hält, aber nicht einmal den Busfahrplan an der Haltestelle versteht. Sie alle kennen doch Schumann, wer kennt ihn nicht. Wer liest, der kennt auch Schumann. Wer hören kann, der hört ihn auch. Wer liebt, der weiß zumindest wen. Und brannten sie nicht darauf, all die Leute, mir mein Sprechen über ihn, Schumann, zu verweigern, sobald ich auch nur ein Wort über ihn sagen würde, und ihres, ihr Sprechen, an die Stelle von meinem zu setzen, egal was ich sagen würde, sie wüßten es in jedem Fall besser. Doch bald merkten sie, enttäuscht, doch erleichtert, merkten sie also, jetzt oder nie würde ihr ganz persönlicher Schumann-Tag kommen. Und dann kam er nicht - was wissen wir nun über den Komponisten, da sein Tag geko men und wieder gegangen war? Mehr oder weniger? und wieder gegangen, ungenutzt, ohne daß ein ganz neuer Schumann von mir gegründet worden wäre, bei dem sie als erste sofort Mitglieder werden dürften. In jedem Fall wüßten sie andres, besseres über ihn und brannten darauf, es auch zu sagen, etwas, das viel eher wert gewesen wäre, in den Abgrund meines Sagens geworfen zu werden, um ihn zu erhellen, denn ich hätte ja selbst keinen Schimmer, das stünde jetzt doch wohl fest! Doch sie würden nie zu Wort kommen. Auf die Unbekannten hört man ja nicht. Kein Wunder, ich habs ja, das Wort, zu dem sie kommen wollen; ich bin am Ball, und hergeben tu ichs nicht mehr. Ich spreche also über Schumann, doch ich bin, was ihn betrifft, nie Ihr Gesprächspartner. Ich sagte also, versuchsweise: Schumann ist letztlich die Stille, in die er mündet. Versuch mißglückt. Zweiter Versuch. Meine Schrift über Schumann entsteht, ja, es handelt sich nur um sie, und mit Entsetzen sehe ich die Verwüstung auf meinem Schreibtisch, in meinem Haus, das ich jetzt verlasse, um nach Mallorca aufzubrechen, nach Palma, aber es handelt sich um das Gegenteil einer Schrift. Meine Schwester wollte zu Besuch kommen, bevor ich abreiste, eine entsetzliche Frau, und doch die einzige, die ich ertrage. Mit einem noch entsetzlicheren, jedoch sehr vermögenden Mann verheiratet gewesen, einem Korkenzieherfabrikanten aus Solingen, doch jetzt kommt sie nicht. Es hat keinen Sinn, wenn sie kommt, denn ich bin weg. Die Schrift. Sie entsteht, indem sie nie entsteht, indem aber unaufhörlich von ihr die Rede ist. Die Schrift übernimmt nun die Vormacht über mein Sprechen, indem sie, als Schrift, nur noch schweigt und schweigt, und das Sprechen natürlich nie ankommt, weil dort, wo sein Zielbahnhof wäre, das blöde Schweigen jetzt steht und nicht abhaut, ich glaub, es hat eine Panne. Und keiner fährts weg. Indem sich die Schrift mi verweigert, kann ich erst mit dem Sprechen anfangen, so ist das mit mir, und ich spreche über nichts sonst als diese Schrift. Doch indem ich spreche, merke ich, was ich vorher schon ahnte: sie ist ja gar nicht mehr nötig, die Schrift! Plötzlich bleibe ich stehen. Ich sage die Schrift, und ich sage die Schrift auf, indem ich gar nichts sage und gar nichts schreibe. Bitte. Jeder Anfang öffnet sich und bleibt dabei schon seinem Ende zugeneigt, wo er ja schließlich hin muß. Dazwischen die Schrift, die will auch noch hinein. Ich habe entsetzlichen Schwierigkeiten, aber das macht nichts. Davon handelt schließlich die Schrift über meine Schrift. Die Leute könnens gar nicht erwarten, von meinen Schwierigkeiten Näheres zu erfahren. Schumann interessiert sie nicht mehr, meine Schwierigkeiten interessieren sie viel mehr. Von denen ist mehr zu erwarten als von Schumann. Von dem haben sie schon alle CDs. Von dem haben sie alle längst genug. Schwierigkeiten haben sie jedoch alle, Schwierigkeiten, die kennen sie. Und von dem, was sie schon kennen, können sie gar nicht genug kriegen. Und es freut sie natürlich, wenn auch andre etwas haben, das sie kennen, nur eben anders. Schumann kennen sie, nur anders, und mehr müssen sie über ihn gar nicht wissen. Er ist grade so angenehm zu hören! Er ist grad im Radio! Die Schrift wird derweil für mich aufgehalten, ich darf jetzt hinein. In Ordnung. Ich gehe also hinein und hinaus, je nachdem, was ich mir abverlange, doch Hauptsache, es ist in meiner Schrift von dieser Schrift die Rede. Mehr braucht sie nicht, die stille Schrift, als daß von ihr die Rede ist. Ja. Glauben Sie nicht auch, daß die ganze Geschichte, die wir zum Glück nicht zur Gänze erlebt haben, nur deshalb wahr ist, weil sie aufgeschrieben wurde? Gewiß nicht. Sie ist ja überhaupt nicht wahr, ob aufgeschrieben oder nicht, man kann sie doch niemals so aufschreiben, wie sie stattgefunden hat. W er würde das alles denn glauben? Das kann doch nicht wahr sein, daß das alles wahr sein soll! Nichts als eine Schrift, auch sie. Aber eine, die nie entsteht. Genau wie meine. Die auch nie entsteht, indem sie entsteht. Ein leerer Papiersack. Sie ist unserem Denken aufgetragen, indem sie geschrieben wurde, doch sie wurde ja gar nicht geschrieben! Was für eine Erleichterung! Die Leute glauben nur, sie wäre geschrieben worden. Wieso hat sie dann nie einer gelesen? So ist das mit dem Wesen der Wahrheit, die es nicht gibt, obwohl sie überall geschrieben steht. Ein blinder Fleck, der aufgeschrieben wurde, indem er nie aufgeschrieben wird. Indem um ihn herumgeschrieben wurde. Um einen blinden Fleck. Und weil sie nicht geschrieben wird, die Wahrheit, stürzen ihr Anfang und ihr Ende immer wieder zusammen, weil nichts sie hält. Sie stürzen sich aufeinander, kann man sagen, indem sie nicht geschrieben werden, nicht gestützt, nicht Anfang, nicht Ende, egal von was, sagen wir halt: Geschichte, indem sie ununterbrochen geschrieben werden, Anfang, Ende, Anfang, Ende. Nicht einmal auf den ersten Tag konnte man sich bisher verständigen, an dem die Wahrheit der Geschichte ihren Anfang nehmen sollte, wieso? Indem ich es schreibe, egal was, entbinde ich Sie davon. Indem ich schweige, zeige ich Ihnen das Innigste, mein Innerstes, das Nichts, das da entsteht, indem ich daran schreibe. So festige ich meine Herrschaft. Indem ich nichts sage, was dann gegen mich verwendet werden könnte. Indem ich alles sage, das ich aber überhaupt nicht sage. Bitte, die Geschichte macht es vielleicht anders, sie entbindet uns, sie zu schreiben, indem sie sich selbst schreibt. Und was herauskommt, um es zu entziffern, ist: nichts. Niemand kann es lesen. Niemand muß es lesen. Es ist nur geschrieben, um nicht geschrieben zu sein. Mein ganzer Körper nur noch ein einziger Schmerz. All die Menschen, die um ihre Geschichte enteignet werden, indem sie sie erleben mußten Und zwar, indem sie gar nichts erlebten. Was, Sie haben das alles erlebt? Aber hier steht es nicht, und hier auch nicht! Es kann also schon mal so nicht stimmen. Der Schicksalsfaden - längst nutzlos abgespult, doch nicht verstrickt! Die Armen! Zwischen den Armen! Und keiner, keiner schreibt über sie und ihre mißtrauischen Empfindungen und die besorgten Gesichter ihrer Eltern, die glaubten, auch aus ihren Kindern würde einmal etwas werden. Ich kann doch nicht alles alleine machen. Ich kann nur über die Größten von ihnen schreiben, mehr Platz habe ich nicht. Für die Kleineren: weniger Platz in mir. Die größten der Namen werden mir soeben gereicht, damit ich sie verwende. Sie schauen und schauen wieder weg und werden doch nicht vergessen. Sie haben ihre Aussichten an der Kasse schon eingelöst, während andre noch, mit strahlenden Gesichtern, auf die herrliche Landschaft vor sich blickten. Sie müssen sich nicht mehr anstellen, die Großen. Die Vergessenen können von mir aus jetzt gehn. Ich lebe allein für mich, und ich lebe nur in meiner Schrift, die umso unerschöpflicher ist, als ich es bin, der sie aus sich herausholt. Die Vergessenen haben wenigstens für ein bißchen Sonne auf einem Berg oder ein bißchen Regen in einem Gesicht gelebt, nur ich, ich lebe nicht, für nichts. Ich schöpfe. Ich lebe nicht. Die Sonne ist nichts für mich. Der Wind ist nichts für mich, und der Regen ist ganz besonders nichts für mich. Ich nehme Schal und Haube und Tabletten gegen das Wetter. Ich lebe schließlich, doch ich lebe ausschließlich, damit mir nichts passiert. Die Geschichte lebt davon, daß das und das passiert ist. Und die Geschichte ist tot, weil sie nicht aufgepaßt hat. Sie ist gestorben, weil ihr das und das passiert ist. Einer sollte uns wirklich zusammenbringen, uns und das von uns nicht, niemals Gesagte, damit wir endlich voneinander abweichen können und : endlich endgültig schweigen dürfen, einig mit uns. © 2000 Elfriede Jelinek "Das Schweigen"
wurde am 27.5.2000 im Deutschen Schauspielhaus Hamburg, im Rahmen des
Theaterfestes aufgeführt. (Jossi Wieler/André Jung) |
| zurück zur Übersicht Texte |
| Alleinsein
Für Jutta Limbach Wer nicht sauber und ordentlich lebt, kann völlig
verkommen, wird dem Mann von seiner Mutter gesagt. Wer ordentlich ist
und trotzdem lebt, dem geht es auch nicht sehr gut, denke ich mir. Zur
Ordentlichkeit wird die Frau angehalten, und der Mann, der kommt als Räuber
und schmeißt alles überall herum. Die Frau macht die Hausarbeit
und versucht, den Sohn dazu anzuhalten. Oder die Schwiegertochter soll
es dann machen. © 2002 Elfriede Jelinek Beitrag für einen
Geschenkband zum Geburtstag von Jutta Limbach |
| zurück zur Übersicht Texte |
| Frauen
Wir gehen jetzt hier herum, weil wir sind, was wir sind: Frauen. Wir gehen also aufgrund unseres biologischen Seins, denn wer fragt danach, wer oder was wir wirklich sind. Wir sind eine Gruppe, die ihre Interessen durchsetzen muß gegen eine Regierung, die ihr Rechte nehmen oder gar nicht erst gewähren will. Auch Rassisten gründen ihre Vorurteile ja auf Biologisches. Sie sind gegen bestimmte Menschen, weil die sind was sie sind, wofür sie natürlich nichts können. Nicht durch Leistung können sie sich in die Gunst der Rassisten hineinschmuggeln, nur manchmal durch Schönheit, wie schwarze Models beweisen, so ziemlich das einzige gesellschaftlich sanktionierte Auftreten, das ihnen zugestanden wird. Für uns scheint, außer Schönheit, noch die Mutterschaft übrig zu bleiben, "familienfreundlich" nennt sich die neue Politik. Die Frau ist ihre Familie. Doch sie wird einerseits, als Mutter, fetischisiert, andrerseits verachtet, mit Almosen abgespeist und vom Arbeitsmarkt möglichst ferngehalten. Also unser Sein als Frau wird vorausgesetzt, es gehört sozusagen zu unserem Seinkönnen in der Welt, und sonst bleibt uns nichts, wenn wir es uns nicht eigens erkämpfen. Mir scheint da, zwischen dem weiblichen Sein und dem des Künstlers, der Künstlerin, genau diese Parallele zu bestehen: einerseits fetischisiert, von der Öffentlichkeit als "prominent" vergötzt (man zehrt auch gern vom Ruhm, den "unsere" Künstler, am besten im Ausland, möglichst weit weg, erwerben), andrerseits als Staatskünstler diffamiert, als Gutmenschen verachtet, als political correctness-Fanatiker lächerlich gemacht. Da oszilliert man also zwischen zwei Formen des Existierens, die beide eigentlich irreal sind. Der Grund eines anderen, einfach nur: zu sein, wird von Leuten in Frage gestellt, die auch nichts anderes sind als der, dem sie seine bloße Existenz nicht zugestehen mögen. Den nennen sie "anders", und daher soll er nicht sein, zumindest nicht bei uns. Der Grund, einfach nur: zu sein, wird also in Frage gestellt. Er darf zwar für uns arbeiten, aber sein wie er ist, das darf er nicht. Er soll anders sein, dann wäre er wie wir. Nein, dann wäre er immer noch nicht wie wir. Er wird nie sein wie wir, egal was er tut. Wir definieren ihn, das ist unsere Macht, wir sind sein Maß. Es wird ihm, ihr keine Voraussetzung zu sein ermöglicht, weil sie immer ein Dazwischen bleiben müssen, die Frauen, die KünstlerInnen UND die Fremden, die am gefährdetsten sind. Sozusagen zwischen sich und sich in der Luft hängend sind sie alle. Als wären sie unentdeckte Kontinente, die erst erschlossen werden müßten, damit man ihre eigene Wahrheit versteht. Aber an der scheint im Moment niemand interessiert zu sein. So werden wir uns wohl weiter endlos sorgen müssen, um Kindergartenplätze, um Arbeitsstipendien, um Räume, unsere Kunst vorzuzeigen, und so weiter, und nur in der Sorge um etwas werden wir sein können. Ein Negativ im Negativ. Es ist seltsam, daß man entschlossen sein und kämpfen muß, nur damit man da sein darf, und das Da Sein will, da schließt sich der Kreis, der Rassist dem Anderen, jedem Anderen, nicht gönnen. Deshalb gehen wir jetzt halt los und schauen mal, wo wir ankommen werden. Dann werden wir weiter sehen. © 2000 Elfriede Jelinek |
| zurück zur Übersicht Texte |
| ÜBER
ELFRIEDE JELINEK
Frank Castorf Aus der Fremdheit der Welt heraus erschreibt sich Elfriede Jelinek, auch als Fremde im eigenen Land, ihre eigene Heimat. Da wird kein Schmerz verniedlicht und kein Widerspruch geglättet. Ihre Sprache ist voller Leben und ist deshalb so notwendig fürs Theater. Sprache, die durch ihre Wahrheit sinnlich wird und ganze Körper zum Sprechen bringen kann. Da sind wir verstört und lasen uns von derselben Elfriede Jelinek retten, wenn sie uns dann aus ironischer Distanz auf ihre eigene Heimat schauen lässt. Zum Weiterleben, sozusagen. Jossi Wieler Jeder hat eine Meinung über sie, auch alle die, die sie nie gelesen haben. Sie ist eine Pop- Ikone ohne Affirmation. Ihre Wirkung ist extrem: Vulgäre Wut oder Hochachtung. Es gibt nur wenige Autorinnen oder Dichterinnen, die so heftig gehasst und wenige, die so überzeugend geehrt und anerkannt werden. Es ist, als ob potentiell die gleichen Leute, die ihr heute einen Preis geben, morgen im Feuilleton über sie herfallen. Dass die deutschen Theaterkritiker Elfriede Jelinek ihr Beharren auf dem Thema des Genozid an den europäischen Juden vorwerfen, und ihren Gedanken nicht ertragen, dass der Schrecken über einen aus Profitgründen zugelassenen fahrlässigen Mord Angst auslöst vor einem (auch aus Profitgründen) systematischen, geplanten vorsätzlichen Massenmord, weil es ihn gab, das ist doch befremdlich. (...) Besonders die etwas altmodischen, sentimentalischen Theaterleute haben an Elfriede Jelineks früheren Stücken das Individuelle, Einzelpersönliche, Psychologische vermisst. Sie haben sich an den Texten von Elfriede Jelinek gestoßen, sie von sich abzustoßen versucht, sich aber doch herausfordern lassen. Sie sind an diesen Texten nicht vorbeigekommen. Und heute muss die Autorin aufpassen, dass sie nicht zur Klassikerin gemacht wird. Aber da wird ihr schon etwas einfallen. Stefanie Carp
Ivan Nagel |